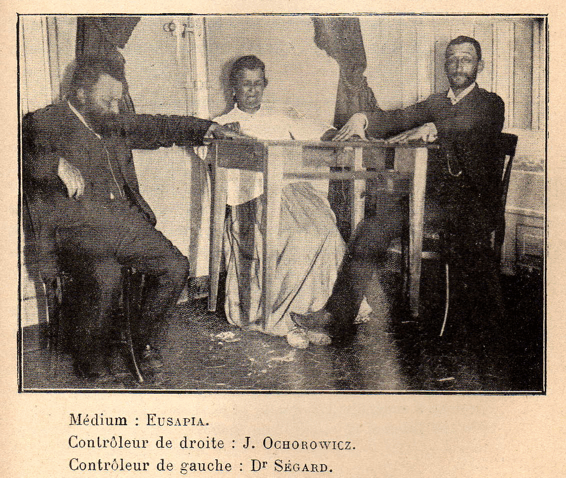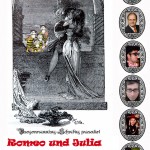Die dritte Wiederholung in Folge rechtfertigt es wohl, von so etwas wie einer Tradition zu sprechen, wenn die Schwabinger Bürgerversammlung auch den Silvesterabend 2010/11 im Vereinsheim gestalten soll. Diesmal bekommt das Projekt den Titel „Romeo und Julia im Wilden Westen“ sowie die weit gefasste Genre-Beschreibung „Neo-Trash-Western-Eso-Musical incl. Lerche und Revolver“ verpasst. Die vielseitigen Interpretationsmöglichkeiten dieser Ankündigung sind der ganz pragmatischen Notwendigkeit geschuldet, alle diese Optionen auch tatsächlich bis zur allerletzten Minute offen zu halten.
Die dritte Wiederholung in Folge rechtfertigt es wohl, von so etwas wie einer Tradition zu sprechen, wenn die Schwabinger Bürgerversammlung auch den Silvesterabend 2010/11 im Vereinsheim gestalten soll. Diesmal bekommt das Projekt den Titel „Romeo und Julia im Wilden Westen“ sowie die weit gefasste Genre-Beschreibung „Neo-Trash-Western-Eso-Musical incl. Lerche und Revolver“ verpasst. Die vielseitigen Interpretationsmöglichkeiten dieser Ankündigung sind der ganz pragmatischen Notwendigkeit geschuldet, alle diese Optionen auch tatsächlich bis zur allerletzten Minute offen zu halten.
Denn schließlich besteht das (inzwischen auch schon traditionelle) Konzept dieser Veranstaltungsreihe im Kern darin, eigentlich gar keines zu haben. So exisitiert für die etwa zweistündige Abendveranstaltung bis zuletzt nur ein knapp vierseitiges Textskelett, an dem sich die Charaktere improvisierend entlang hangeln müssen. „Wie üblich fallen Probezeit und Premiere mehr oder weniger zusammen“ schreibt dann auch die Süddeutsche Zeitung in ihrer Ankündigung ganz treffend.
Die allergrößte Unbekannte in diesem Spiel gegen alle guten Regeln des geordneten Theaterbetriebs bleibt allerdings das Publikum und dessen Reaktion auf die Bühnenanarchie mit nach unten offener Niveauskala. Nach den beiden vergangenen Jahreswechseln sollten eigentlich alle gewarnt sein. Trotzden hat Johanna Leitner, Kompetenzträgerin des Vereinsheims für Vor- und Ausverkauf auch diesmal schon wieder lange vor „Proben“-Beginn nahezu sämtliche Tickets verscherbelt. Aber vielleicht liegt das ja auch nur an dem 3-Gänge-Menü, das der Veranstalter als einzig geordnetes Element des Abends im Pauschalpreis eingeschlossen hat?
So hält sich bei mir – und auch das hat Tradition – das schmeichelhafte Gefühl, trotz meiner schwabingfernen Wohnadresse (am Hauptbahnhof über den Bahnsteig von Gleis 11 und dann durch die Ladezone der Mitropa) wieder auf die Bühne eingeladen zu werden in etwa die Waage mit der pathologischen Urangst, dort ohne Text und Ideen nackt im Rampenlicht zu stehen.
Die ersten Arbeitstreffen sind nicht wirklich angstabbauend: Der schwabinger Bürgerversammlungs-Kern aus Till Hofmann, Sven Kemmler, Michi Sailer und Moses Wolff hat mich schon vorab in Abwesenheit zum Romeo berufen. Und hat außerdem – ein noch nie dagewesenes Ereignis in der Geschichte der Versammlung – eine Frau in die Reihen aufgenommen. Was für eine, das wird mir gleich bei der ersten Begegnung in aller Dramatik klar: Marlene Morreis ist mit Energie, Austrahlung und Explosivität gesegnet wie ein Atomkraftwerk knapp vor der Kernschmelze.
Gerade frisch von der Schauspielausbildung in New York zurück, wird sie vermutlich in einigen wenigen Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Hollywood-Karriere einen vielstelligen Dollarbetrag aufbringen, um diesen Silvesterabend aus ihrer Vita und dem kollektiven Gedächtnis tilgen zu lassen. Für den Augenblick aber ist sie per Dekret des Skripts mit mir verlobt, ein Umstand, dessen Stanislawski-gerechte Vermittlung an das Publikum einigen Überbau aus elterlichem Zwang und jugendlicher Naivität und großer Furchtlosigkeit notwendig macht.
Eine gewisse Furchtlosigkeit fordert das Unternehmen auch von allen Darstellern – immerhin sieht das Konzeptskelett vor, als Schlussbild das berühmte Kommune-1-Gruppenfoto in der Original-Kostümierung nachzustellen. Damit es vorher auch etwas auszuziehen gibt, absolvieren wir einen wundervollen Besuch im Kostümverleih, wo ich als Ergänzug zu meinem Mausgrauen Sacko (ein Relikt einer anderen Versagerrolle an der Pasinger Fabrik) noch einen Überwurf im modischen Müllsack-Schnitt bekomme, während meine Verlobte mittels eines Korsetts weiter aufgerüstet wird.
Über solchen Vorbereitungen vergehen dann auch die wenigen „Probentage“ wie im Fluge und ehe wir uns versehen ist auch schon Silvester und dann ist es plötzlich auch schon sehr spät und wir werden von Johanna Leitner, der Beauftragen des Vereinsheims für elementare Struktur und Ordnung (BeSO) auf die Bühne gejagdt.
Dort dürfen die Dalton-Brüder zunächst einzeln etwas Selbstdarstellung betreiben. Dank meiner mangels Probe unverbrauchten Ahnungslosigkeit kann auch ich mich dabei noch trefflich amüsieren, besonders über Sven Kemmler als Sartre-affinen Pistolero. Doch dann beginnt die Interaktion der Figuren, die in weiten Strecken von einer dadistisch anmutenden Grundsatzdebatte der Trias Sex, Drogen und Rock’nRoll geprägt ist.
Ich komme der schriftlich niedergelegten Anweisung, meiner die freie Liebe predigenden Verlobten impertinent mit der Sehnsucht nach einem monogamen, bauspar-finanzierten Reihenhaus nachzusteigen, so lange konsequent nach, bis Julia den Revolver als letztes Mittel zum Baustop begreift. Was anschließend geschieht, lässt sich bei mir nur noch fragmentarisch aus dem Gedächtnis abrufen. Wir halten uns aber nach bestem Wissen und Gewissen an die einige Tage zuvor abgegebene Pressemitteilung [PDF].
Immerhin ein Teil des Gesamtkonzepts geht (beinahe, s.u.) reibungslos auf: Das Publikum, mittels Hauptspeise in eine verdauende Erduldungsstarre sediert, folgt dem diffusen Auftakt ohne Murren. Im weiteren Verlauf halten sich dann die Erosion des schlüssigen Plots und die Trunkenheit im Saal in etwa die Waage. Und schließlich endet alles im tumultartigen Jubel einer übergangslos einsetzenden Party, in deren Verlauf noch weitaus schrägere Paarungskonzepte zu beobachten sind, als vorher auf der Bühne dargestellt. Erst im Morgengrauen gelingt es Johanna Leitner (BeSO), den Saal einer (auch wirklich erforderlichen) Grundreinigung zuzuführen.
Fazit: Ich ziehe erschöpft und gezeichnet vom angetrockneten Angstschweiß, aber mit einer diffus-glücklichen Erinnerung in ein neues Jahr. Und die teilt offenbar auch das ganze Publikum.
P.S.: Das ganze Publikum? Nein, ein von unbeugsamen Bildungsbürgern bevölkerter Tisch hört nicht auf, der Erosion des Niveaus Widerstand zu leisten. Und so muss Johanna Leitner, Beauftrage des Vereinsheims für Sanftmut und Weltfrieden in den ersten Tagen des neuen Jahres doch noch eine erboste E-Mail beantworten, in der das Ensemble unter Verweis auf Goethe und Schiller darüber aufgeklärt wird, dass der Abend trotz anderweitiger Spontanäußerungen aus dem Publikum nicht komisch und unterhaltend gewesen sei.