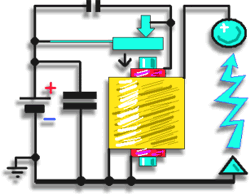Dschungelcamp im Wiener Wald
 Christian Stückl inszeniert am Münchner Volkstheater Ödön von Horváth fürs Privatfernsehen.
Christian Stückl inszeniert am Münchner Volkstheater Ödön von Horváth fürs Privatfernsehen.
7, 5 Millionen Zuschauer zum Auftakt der 9. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ können nicht irren? Das mag sich Christian Stückl gefragt haben, als er am Münchner Volkstheater die Inszenierung der jahrzehntelang in der gymnasialen Oberstufe verschlissenen „Geschichten aus dem Wiener Wald“ in die Hand nahm. Denn was es als Resultat auf der Bühne des Münchner Volkstheaters zu sehen gibt, setzt mit kompromissloser Konsequenz auf alle Elemente des Dschungelcamp-Erfolgsformats.
Ins Camp eingezogen sind die hinreichend bekannten C-Promis aus der Deutschstunde: Marianne (Lenja Schultze), bildungsferne Tochter aus dem Ein-Euro-Shop des Zauberkönigs (Jean-Luc Bubert), die im Kurz-Vorkriegsösterreich vor ihrer Verheiratung mit Oskar (Pascal Fligg), Metzger aus Leidenschaft, im letzten Augenblick in die Arme und Lenden des metrosexuellen Alfred (Max Wagner) flüchtet und ihre diesbezügliche Entschlossenheit mittels unehelichem Nachwuchs Leopold (nur akustisch wahrnehmbar) unterstreicht.
Für die pseudo-archaische Naturkulisse sorgt im Volkstheater die bühnenfüllende Waldidyll-Fototapete mitsamt vorgelagertem Teichfolien-Feuchtbiotop, in dem sukzessive das gesamte Ensemble baden geht und aus dem zwischendurch (Ekelprüfung) auch mal getrunken wird. In durchnässter Garderobe wird beim Planschen der ein oder andere Koitus angedeutet – gelegentlich auch mal mit entblößtem Busen, aber selbstverständlich doch stets fernsehgemäß in den Grenzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Totale Nacktheit geht auch schon deshalb nicht, weil im Reality-TV ja alle Figuren stets so grell kostümiert sein müssen, dass sie auch im YouTube-Video auf einem Handybildschirm noch sicher auseinander zu halten sind – eine Anforderung, der die Volkstheater-Inszenierung (Bühne und Kostüme: Stefan Hageneier) mit einer Kostüm-Farbpalette quer durch das Sortiment aller handelsüblichen Textmarker bravourös nachkommt.
Als retardierende Momente des exhibitionistischen Spektakels gibt es einige – auch im TV immer wieder gern zwischengeschobenen – divergent talentierten Gesangseinlagen zur Klavierbegleitung.
So ist nach spätestens 15 Minuten klar: Horváths biederes Spießeridyll, dessen Bestialität der Zuschauer in der traditionellen Darstellung erst noch selbst nach und nach enttarnen muss, ist hier vom ersten Augenblick an eine Freakshow, deren Kandidaten sich mit allen Registern aus Hysterie, Zote und schwülen Andeutungen an den Zuschauer heranzuwerfen scheinen. Dementsprechend gibt es in den Figuren kaum mehr Geheimnisse zu entdecken und auch keine charakterliche Beweglichkeit. Horváths im Bürgergewand getarnte Monster wirken folglich in etwa so erschreckend, wie die elektrischen Zombies in der Geisterbahn und sogar Nachwuchs-Nazi Erich (Johannes Meier) verliert als sich ständig selbst herumkommandierender blondierter Pfadfinder mit Schusswaffe jede Bedrohlichkeit.
Im TV ist diese Berechenbarkeit ein entscheidendes Erfolgskriterium, um nach Bierhol-Auszeit oder anderer Bedürfnisverrichtung nicht die gedankliche Wiedereingliederung ins fortlaufende Programm zu gefährden. Im Volkstheater aber beginnt sich das Publikum nach etwa einer Stunde deutlich hörbar zu langweilen, weil sich der Herrenwitz-Marathon irgendwann totgelaufen hat und außerdem im Unterschied zum heimischen TV hier die Gelegenheit fehlt, nebenher zu bügeln oder Geschirr zu spülen. Die nach 90 Minuten recht plötzlich hereinbrechende Pause löst deshalb spürbare Erleichterung im Saal aus.
Anschließend gewinnt die österreichische Dschungel-Soap tatsächlich doch noch einmal an Kraft. Nach einiger Slapstick-Artistik an der bayerischen Bierbank steuert die Handlung unausweichlich auf Horváths demaskierendes Finale hin: Mariannes Kind wird sterben, weil seine entmenschte Großmutter (Ilona Grandke) es mutwillig der kalten Nachtluft aussetzt – ein Detail, das leider im Volkstheater untergeht und so den Blick darauf verstellt, mit welcher Grausamkeit sich die Großmutter mit ihrem autoritären Fazit „Wo kein Segen von oben dabei ist, das endet nicht gut und soll es auch nicht!“ selbst zum Vollstrecker ihres rachsüchtigen Gottes erklärt.
Als aber im inzwischen stark vermüllten Idyll schließlich alle um den leeren Kinderwagen herumstehen, ist es nach zwei Stunden Gebrüll, Geschepper und kleineren Detonationen plötzlich totenstill auf der Bühne – die grellen, lauten Figuren wirken im Angesicht der Katastrophe vollkommen hilflos überfordert und können gerade dadurch doch noch einmal anrühren. Schlussendlich landet Marianne so doch noch in den zupackenden Armen ihres beständigen Metzgers („Meiner Liebe entkommst du nicht!“), der ihr im Moment des finalen Blackouts leidenschaftlich in den Hals beißt.
Persönliches Fazit: Stückl inszeniert konsequent nach den Regeln des „Unterschichtenfernsehens“ – und fängt sich damit zwangsläufig alle Gemüts- und Geschlechtskrankheiten dieses Genres ein. Worauf sich leicht mit einigem Geschrei über die Profanisierung der Horváthschen Hochkultur reagieren ließe.
Sobald aber der erste Zorn verflogen ist, beginnt die Entdeckung, welche neuen Eindrücke aus der Verbindung der beiden Kulturwelten entstehen: Der Zuschauer erwischt sich irgendwann selbst in der Rolle des schadenfrohen TV-Voyeurs mit der selbstgerechten Überzeugung, dass die eitlen und unsympathischen Fatzkes auf der Bühne es auch nicht anders verdient hätten. Und wird schlussendlich von der wahrhaften Tragik der Horváthschen Vorlage umso mehr getroffen.
Die Abscheu vor den sich völlig würdelos prostituierenden Figuren weicht dabei dem Respekt an das dahinter verborgenen Ensemble, das sich schonungslos allen physischen und psychischen Qualen des menschenverachtenden Reality-TV-Formats ausliefert und es womöglich gerade durch manches darstellerische Understatement fertig bringt, den Zuschauer irgendwann sein Abitur und den dahin führenden Deutschunterricht vergessen zu lassen.
Trotz der Umsetzung in einem Belanglosigkeits-Format: Belanglos ist der Abend im Volkstheater also ganz gewiss nicht. Über gewisse Strecken ist er sogar sehr unterhaltsam. Vielleicht lohnt es sich jedoch, für die 30 Minuten vor der Pause das Strickzeug mitzubringen.