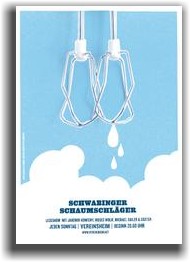Wiesn-Wunden-Lecken
Veranstaltung am 06. 10. 2008 – Blickpunkt Spot Vereinsheim, München.

Aus is! Die Zelte des Oktoberfests 2008 haben die letzten Freunde bierseeliger Gemütlichkeit ausgespien. Zeit, die Wunden aus dem zweiwöchigen Exzess zu lecken. Moderator Michi Sailer steht allen voran mit einer frisch genähten veritablen Platzwunde der Augenbraue auf der Bühne, an deren Entstehung er nur fragmentarische Erinnerung besitzt. Zusammen mit dem vom Tresenpersonal fürsorglich immer wieder frisch gefüllten Eisbeutel eine durchaus überzeugende Austaffierung für seine Schwabinger-Krawall-Geschichten.
Bevor er die erste verlesen darf, tobt als Kurzleihgabe aus dem Lustspielhaus Bülent Ceylan über die Bühne. Der spielt sehr lebendig und spontan mit den Deutsch-Türkischen-Klischeeverirrungen und legt dann noch einen furiosen „Bauchtanz“ hin. Ebenfalls mit viel Baucheinsatz setzen dann „Die Pertussis“ den Abend fort.
Moses Wolf greift dann wieder das Oktoberfest-Thema auf und gibt grantlerisch-grenzdebile Wiesn-Erinnerungen zum besten.
Ich selber habe nach acht Jahren des Wohnens im Epizentrum der Gemütlichkeit meine Lektionen gelernt (während der Festwochen im Geist um JEDEN Passanten einen Kreis mit dem Radius von dessen ausgestreckter Körperlänge ziehen und diesen weder betreten noch befahren) und bin ohne physische Blessuren davon gekommen. Dafür kann ich von türsteher-bewehrten Supermärkten und in unternehmerischer Eigeninitiative betriebenen Spontanbiergärten und Bedarfslatrinen im Oktoberfest-Erweiterungsgelände (vulgo: Vorgärten) berichten. Größte Publikumsresonanz erzeugt meine zweizeilige Spontanabrechnung als Kollateralschaden des Oktoberfestes:
Ey, ihr Bierzelt-Arschgesichter,
ihr seid dicht – doch ich bin Dichter!
Der Höhepunkt des Abends dann ganz zum Schluss: Tanztelegramm! Deren „Progressivpop im Dialekt“ (Selbstdefinition) ist melodisch eingängig und abwechslungsreich komponiert, klar und transparent abgemischt, mit musikalischer Perfektion vorgetragen – und greift im krassen Gegensatz zum üblichen Deutschpop-Brei in seinen Texten unverbrauchte Themen in origineller und poetischer Weise auf. Zu allem Überfluss scheint die Dreier-Boygroup auch noch unter allen weiblichen Gästen die Mutter- oder besser noch Schwiegermutter-Sehnsucht zu wecken. Tosender Applaus, Zwangszugabe. Allerbeste Stimmung.
Tief in der Nacht kehre ich glücklich mit dem Radl heim und freue mich auf der Hackerbrücke still daran, dass es zum ersten Mal seit zwei Wochen nicht mehr so aussieht, wie auf einem apokalyptischen Hieronymus-Bosch-Gemälde.