Einfach reich beschenkt: Luise Kinseher im Lustspielhaus
 Zunächst scheint alles ganz einfach: Luise Kinseher will aussteigen, die einsame Alm in den Schweizer Alpen ist schon bezahlt. Und so erscheint sie gleich am Anfang ihres Soloprogramms Einfach Reich mit dem Bündel der Geldscheine aus der Abendkasse, um ihren Abschied zu verkünden und das Eintrittsgeld zurückzuzahlen.
Zunächst scheint alles ganz einfach: Luise Kinseher will aussteigen, die einsame Alm in den Schweizer Alpen ist schon bezahlt. Und so erscheint sie gleich am Anfang ihres Soloprogramms Einfach Reich mit dem Bündel der Geldscheine aus der Abendkasse, um ihren Abschied zu verkünden und das Eintrittsgeld zurückzuzahlen.
Aber so einfach geht es dann doch nicht: Der unbürokratischen Rückzahlung steht plötzlich Frau Buchhalterin Rösch entgegen, die als Fleischwerdung der Kinseherschen Krämerseele erst einmal vorab eine steuerwirksame Quittung von jedem Gast einfordert. Sich aber dabei sofort mit der shopping-affinen Frau Lachner aus dem Marketing überwirft. Dann platzt auch noch die gealterte Diva Frese in die Runde, um die Führung einer ökonomisch optimierten Ehe zu erläutern („Wo hat mein Heinz die Banane her? Sein Taschengeld reicht dafür nicht …“) und mittendrin krakeelt „Mary from Bavary“ herum, die der Einsamkeit genauso ab- wie dem Alkohol zugeneigt scheint.
Ein solcher Tumult aus Darstellern ist an sich schon erstaunlich für einen Soloabend. Noch erstaunlicher aber ist, dass es dazu weder Verkleidungsexzesse noch alberner Requisiten bedarf: Die Figuren enstehen mitten auf der Bühne allein aus Luise Kinsehers Mimik, Gestik und Sprache. Und zwar so instantan, dass sie sogar miteinander Dialoge führen können, ohne dass je der Faden verloren geht. Die ungeheure Präzision dieses Wechselspiels ist ganz sicher auch ein großer Verdienst der Regisseurin Beatrix Doderer.
Was den Abend aber jenseits aller darstellerischen Perfektion zum großen Ereignis macht, ist der kluge, scharfe aber doch wohlwollende Blick auf das menschliche Wesen. Denn die vielen Seelen, die wohl (ach!) in jeder Brust wohnen, sind nirgendwo alle einzeln mit ihren schwergewichtigen Bedenken in solcher Leichtigkeit zu erleben wie im Kinseherschen Kabarett.
Auf diese Weise wird das Ringen um Geld und Glück zu einem Streifzug durch die Seele jedes Zuschauers: Die schräge Damenriege ertappt nacheinander die Charakterdefizite des Betrachters und lockt ihn in den guten Vorsatz, es ab sofort viel besser machen zu wollen. Aber nur, um ihn Augenblicke später die totale Vergeblichkeit dieses Versuchs begreifen zu lassen.
So bleibt am Ende auch die Frage offen, ob die immer wieder hoch gelobten Kühe der Schweizer Alpen wirklich die besseren Menschen sind. Denn schließlich hält „Mary from Bavary“ noch ein berauscht-berauschendes Schlussplädoyer für das ganz menschliche Beisammensein. Dieses Sein scheint auch das Publikum ganz außerordentlich zu genießen. Denn im Applaus zeigt sich die große Einmütigkeit, mit den Weisheiten des Abends viel, viel besser weggekommen zu sein, als mit einem rückerstatteten Eintritt.
Auf diese Weise schnödes Geld gegen den Reichtum der Kinseherschen Klugheit einzutauschen, sei jedem Glücksucher aufs Wärmste angeraten. Wenn es ihm denn gelingt, Karten für eine der (ganz zurecht) auf Monate hinaus ausverkauften Vorstellungen zu ergattern. Aber es kann ja auch nicht alles einfach sein.
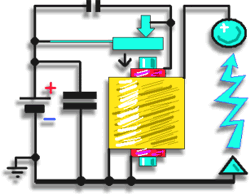
 „Hollaröhdulliöh!“ Der Watzmann ruft. Mich einmal wieder als Zuschauer ins
„Hollaröhdulliöh!“ Der Watzmann ruft. Mich einmal wieder als Zuschauer ins